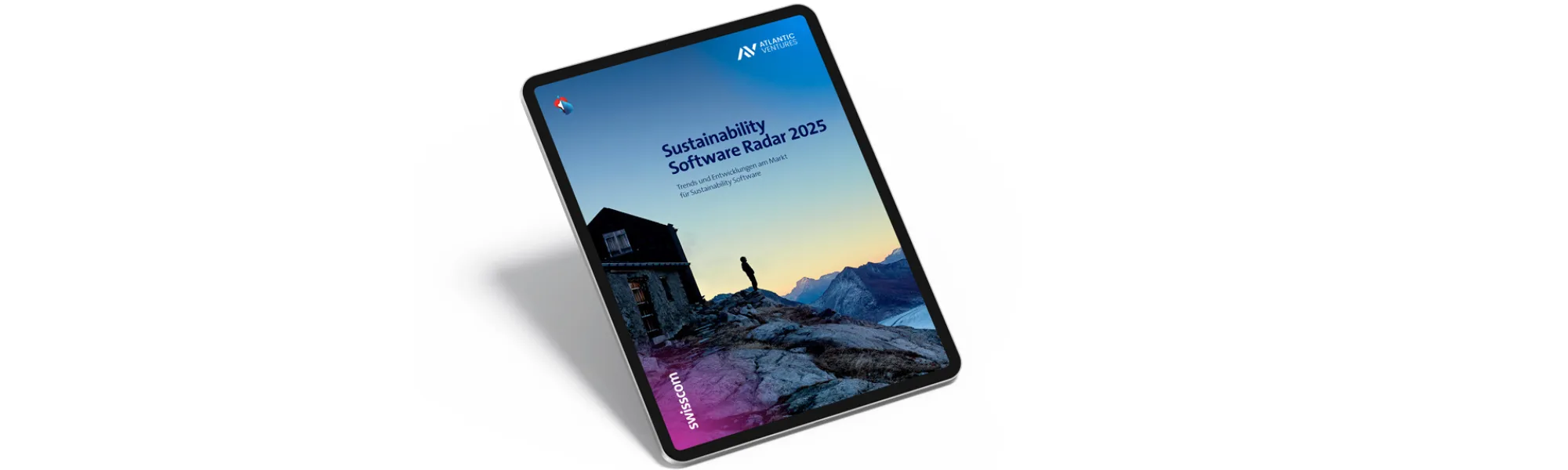Forum ö 2018: 3 Fragen an Sunnie J. Groeneveld
Ist Schweizer Unternehmen die Agenda 2030 mit ihren Sustainable Development Goals ein Begriff? Wie engagiert erleben Sie die einzelnen Unternehmen in dem Bereich?
Ich denke das Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit und die Agenda 2030 ist in vielen Schweizer Firmen heute vorhanden, aber nur wenige sind auch konsequent in der Umsetzung. Ein Beispiel einer Firma, die sich konsequent für das Thema Nachhaltigkeit einsetzt und ich aus erster Hand kenne, weil wir sie seit 2014 mit unserem Beratungsunternehmen Inspire 529 unterstützen dürfen, ist die Baufirma und öbu-Mitglied Losinger Marazzi. Bei der Entwicklung und dem Bau von nachhaltigen Wohnarealen nehmen sie in der Schweiz eine Pionierrolle ein.
Sie haben unter anderem das Erlenmatt West Areal in Basel realisiert, welches 2017 vom Bundesamt für Energie als eines der schweizweit ersten 2000-Watt-Areale in Betrieb zertifiziert wurde. Die Zertifizierung orientiert sich an der Vision einer 2000-Watt-Gesellschaft. 2500 Watt pro Kopf beträgt der Primärenergieverbrauch heute im weltweiten Durchschnitt – mit enormen länderspezifischen Unterschieden. In der Schweiz verbraucht jede Person aktuell etwa 5500 Watt. Die Immobilieninvestoren, welche diese 2000-Watt-Vision finanziert haben, sind alle aus der Privatwirtschaft, unter anderem ist auch Credit Suisse, Patrimonium und Vaudoise dabei. Erlenmatt West in Basel ist für mich das perfekte Beispiel, das zeigt, was möglich ist, wenn sich verschiedene Akteure entlang der Wertschöpfungskette für die Nachhaltigkeit einsetzen.
Welche Megatrends werden in Zukunft die Schweizer Wirtschaft beschäftigen?
In immer kürzeren Abständen werden Fortschritte in Cloud Computing, Big Data, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, Internet of Things, Blockchain als auch Robotics erzielt. Das eröffnet neue Möglichkeiten und treibt die digitale Transformation über alle Wirtschaftssektoren hinweg an. Doch nicht nur die technologischen Treiber der Digitalisierung werden die Schweizer Unternehmen heute und in Zukunft beschäftigen, sondern auch der damit einhergehende Unternehmenskulturwandel, der nötig ist, um die digitale Transformation gemeinsam mit allen Mitarbeitenden erfolgreich zu meistern.
Wie kann man als KMU die digitale Transformation angehen?
Die digitale Transformation erfordert zunächst von allen Neugierde und die Bereitschaft des lebenslangen Lernens. Auf der Ebene des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sollte man sich mit den verschiedenen Megatrends auseinandersetzen und - allenfalls unterstützt durch einen Berater oder einen digitalen Beirat - die digitale Strategie des Unternehmens formulieren.
Darüber hinaus gilt es insbesondere innovative Mitarbeitende stärker in der Organisation zu befähigen. Aktuell ist es in der Schweiz tendenziell leider immer noch so, dass wir in der Masse zu viel Angst vor dem Scheitern haben, mehr Gärtchendenken als nötig tolerieren und einen übergrossen Hang zum Perfektionismus aufweisen. Das bremst innovative Köpfe aus, insbesondere auch jene, welche zukunftsweisende Themen vorantreiben. Gerade bei Digitalisierungsprojekten sind Geschwindigkeit und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit erfolgsentscheidende Faktoren. Deswegen wäre ein weiterer Ansatzpunkt, eine zukunftsfähige Unternehmenskultur zu fördern, indem man interne Initiativen lanciert, die darauf abzielen, dass Mitarbeitende abteilungs- und hierarchieübergreifend zusammenarbeiten, neue Ideen laufend ausprobieren, und die Umsetzung dieser Ideen mit Rückhalt des Managements rasch vorantreiben können.

Sie möchten mehr über digitale Innovationen, die Agenda 2030 und die Zukunft der Schweizer Wirtschaft erfahren? Kommen Sie am 17. Mai 2018 zum Forum ö in Zürich - jetzt anmelden.