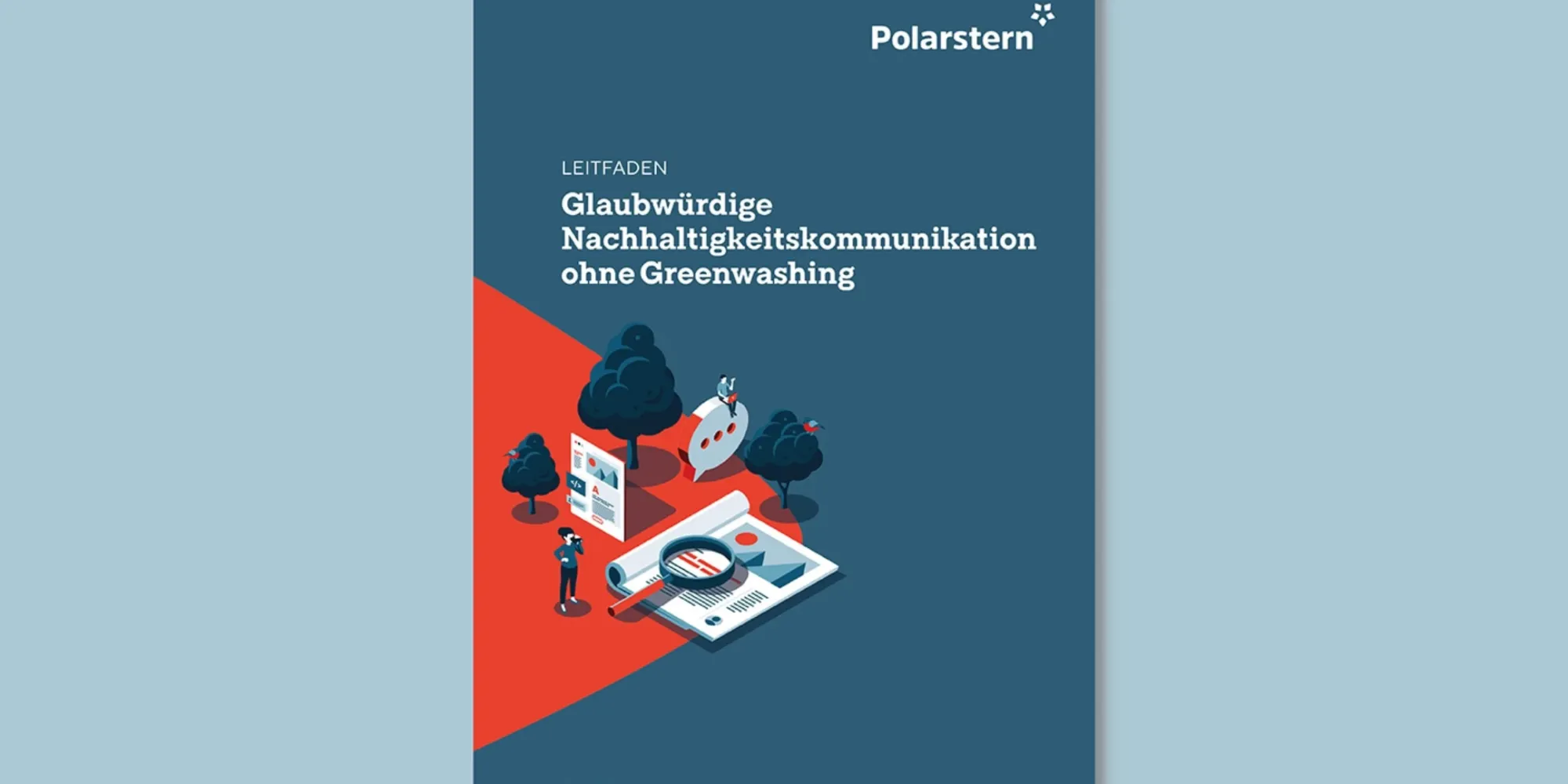Gastbeitrag: Mit Design Thinking nachhaltige Lösungen entwickeln
Viele Herausforderung im Nachhaltigkeitsbereich überfordern uns und scheinen kaum lösbar. Sei es die nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft, die Verbesserung des Tierwohls oder die Veränderung des Konsumverhaltens - wir verfügen selten über alle notwendigen Informationen für konsolidierte politische oder auch unternehmerische Entscheide. Zudem wandelt sich das Umfeld ständig und oftmals verfolgen verschiedene Anspruchsgruppen sich widersprechende Ziele. Im Englischen nennt man diese Herausforderungen «wicked problems», auf Deutsch sinngemäss «vertrackte Probleme». Damit bezeichnet werden komplexe Probleme oder Herausforderungen, bei denen die Lösung nicht sofort auf der Hand liegt.
Armut hängt zusammen mit Bildung, Ernährung mit Armut, der Klimawandel mit der Ernährung und so weiter. Schon nur das Problem zu beschreiben hängt von der Perspektive des Erzählers ab. Oft werden diese Probleme den politischen Entscheidungsträgern delegiert, oder sie werden als zu generell abgeschrieben. Aber es sind genau diese Herausforderungen, die uns alle berühren: Armut, Gesundheit, Gleichberechtigung, Wohlergehen – Themen der Nachhaltigkeit.

Bedürfnisse der Menschen ins Zentrum rücken
Design Thinking ist eine Methode, um die Bedürfnisse der Menschen ins Zentrum zu rücken und interdisziplinär kreative Lösungen für praktische Probleme zu finden. Wichtige Schritte sind dabei Verstehen, Erforschen, Prototypisieren und Bewerten. Ideen werden früh in der Projektentwicklung bei Anspruchsgruppen getestet, um herauszufinden, ob sie das Kernproblem lösen oder nicht. In schnellen Lernzyklen wird so eine Lösung gefunden, die die Menschen optimal zufriedenstellt. Zahlreiche Unternehmen nutzen die Methode für kundennahe Innovationsprozesse, die bedürfnisorientiert und relativ rasch Produkte hervorbringen. Dieselbe Methode kann auch für das Entwickeln von menschenzentrierten Lösungen im Nachhaltigkeitsbereich angewendet werden. Beispiele dafür gibt es bereits in der Praxis: das entwickeln sanitärer Einrichtungen und Systeme gemeinsam mit der Bevölkerung («community led total sanitation» CLTS), effiziente Materialverwendung in Produkten und Verpackungen sowie das Entwickeln von bedürfnisorientierten Verwaltungsprozessen gehören dazu.
Design Thinking führt zu konkreten Ergebnissen
IDEO, ein globales Designunternehmen, hat sich ganz der Suche nach besseren ökologischen und sozialen Lösungen verschrieben. Ein typisches Beispiel für Design Thinking ist ihr Projekt «Designing Waste out of the Food System», mit dem sie einen Beitrag zur Verminderung der Lebensmittel-Verschwendung leisten wollen. Gemeinsam mit Hotelbetreibern, Stiftungen, Unternehmern und Nahrungsmittel-Produzenten haben sie im Auftrag der Rockefeller Foundation aus 450 Projektideen 12 für die Umsetzung ausgewählt. Darunter waren zum Beispiel Projekte, die den Einkauf und die Verteilung von Nahrungsmitteln besser organisieren oder auch die Erfindung von technischen Systemen, die aus Essensresten und Papier kompostierbaren Plastik herstellen. Das Gesamtprojekt war so erfolgreich, dass sogar eine «Food Waste Alliance» unter den Akteuren gegründet wurde, um die Kooperation zu stärken
Ein Design Thinker fragt sich, wie die Dinge funktionieren könnten
Design Thinking ist eine Denkweise, die sich von unseren gewohnten analytischen Ansätzen unterscheidet und diese ergänzen kann. Ein Analytiker fragt sich, wie die Dinge heute tatsächlich funktionieren. Ein Design Thinker fragt sich, wie die Dinge funktionieren könnten. Sowohl die Problemwahrnehmung wie auch die Lösungsansätze verschieben sich dadurch, beispielsweise von «wir müssen den Armen helfen» zu «die können das»; oder von externen Lösungen und Standards zu lokaler Umsetzung; oder von Ressourcenverschwendung zu Verpackungen, die Kunden einfach entsorgen/weiterverwenden können. Design Thinking als Denkweise charakterisiert sich durch Einfühlungsvermögen, Optimismus, Kreativität und der Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen. Es erfordert exploratives, kreatives Denken um sowohl an die Problem- wie auch an die Lösungsfindung breit heranzugehen. In der Problemdefinition wie auch in der Fokussierung auf eine Lösung liegt dem Prozess analytisch-definierendes Denken zugrunde. Design Thinking ist eine Verbindung zwischen Kreativität und analytischem Denken.
Neue Lösungen für alte Problemen
Design Thinking bringt nachhaltige Lösungen hervor, wenn wir Innovation an der Schnittstelle von menschlicher Erwünschtheit, technischer Machbarkeit, wirtschaftlicher Rentabilität und Umwelt- und Sozialverträglichkeit suchen. Der Anwendung dieser Methode sind keine Grenzen gesetzt: wir können damit neue Dienstleistungen oder Produkte entwickeln, die Zusammenarbeit in unserer Organisation neugestalten oder das nächste Projekt mit frischem Wind andenken. Auch die Grössenordnung der Fragestellung kann unterschiedlich sein – von der Organisation des Recyclings im Betrieb bis hin zum «wicked problem», das sich der Politik stellt. Mit Design Thinking lernen wir schnell, welche Bedürfnisse verschiedene Anspruchsgruppen haben und wie sie bestmöglichst befriedigt werden können.
Ein Tageskurs zum Design Thinking
In unserem Tageskurs, den wir gemeinsam mit INNOarchitects AG durchführen, wird praxisorientiert und im Kontext der Nachhaltigkeit ins Design Thinking eingeführt. Kursteilnehmenden arbeiten an Praxisbeispielen aus dem Nachhaltigkeitsbereich und lernen, wie iteratives Vorgehen zu schnellen und innovativen Ergebnissen führt. Sie entwickeln ein Verständnis für Methode, Prozess und Denkweise des Design Thinking, und unterstützen sich gegenseitig mit Lösungsansätzen. Nota bene: Ins Design Thinking wird in unserem Lehrgang «Umweltberatung» ebenfalls eingeführt.

Im Rahmen der öbu-Gastbeiträge kommen in regelmässigen Abständen Gastautoren auf unserer Website zu Wort. Unsere Gastautoren sind ExpertInnen auf einem Themengebiet der nachhaltigen Wirtschaft und Entwicklung und geben einen Einblick in ihre tägliche Praxis, berichten über neue Erkenntnisse oder hilfreiche Instrumente aus ihrem Fachgebiet. Als Gastbeitrag markierte Beiträge geben die Meinung der jeweiligen Autoren wieder und nicht immer diejenige des Verbands.
Sind Sie selber interessiert daran, kostenlos einen Gastbeitrag auf oebu.ch zu verfassen, dann melden Sie sich bei seithel@oebu.ch.