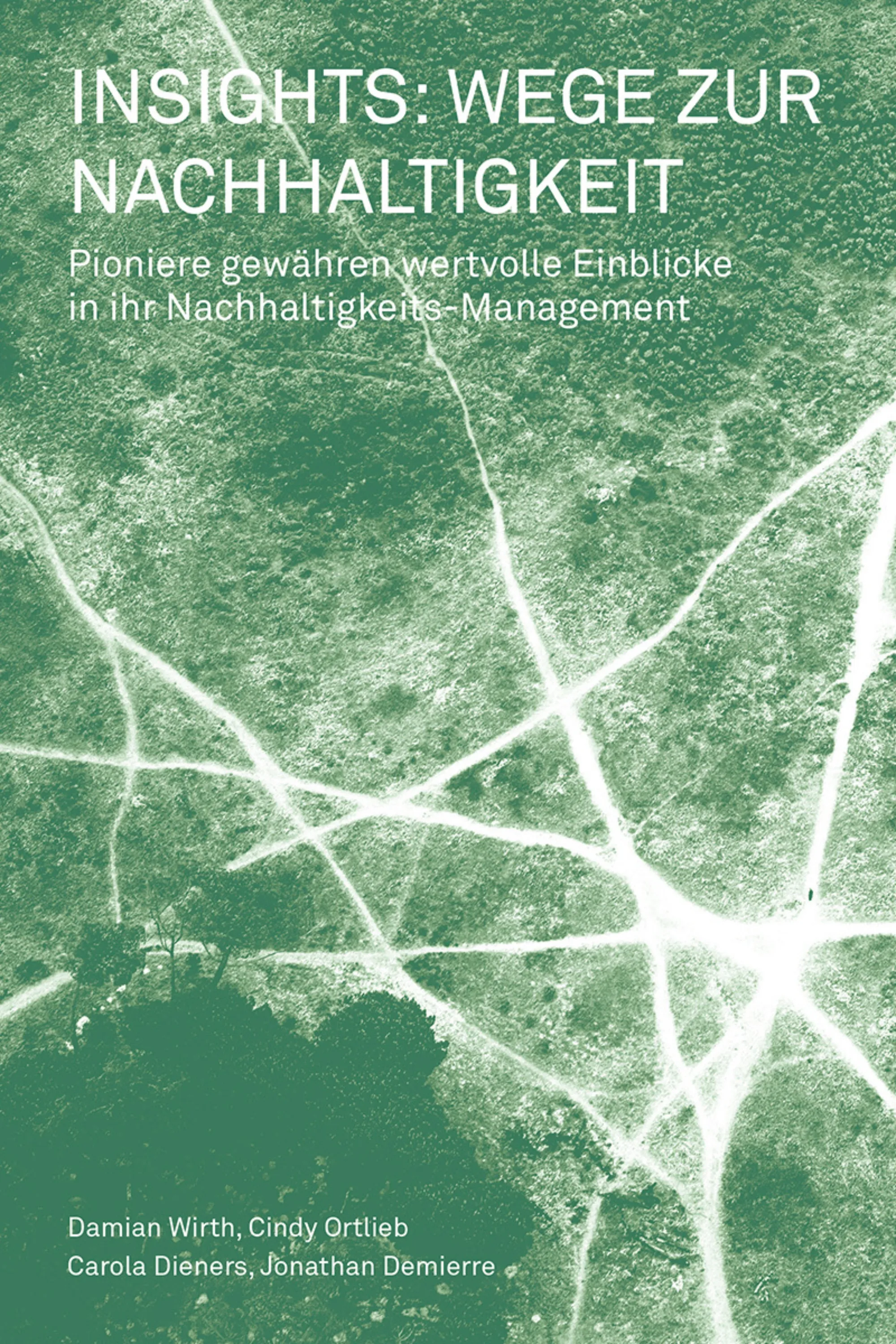EU-Omnibus-Vorschlag: Bedeutung für CSRD und CSDDD mit persönlicher Einordnung von Olmar Albers
Ausgangslage
Ende Februar hat die Europäische Kommission offiziell ihren Vorschlag für die Omnibus-Verordnung vorgelegt. Die daraus resultierenden Änderungen zielen darauf ab, den Aufwand für Unternehmen überschaubar zu halten, gleichzeitig bringt der Vorschlag aber auch wesentliche Änderungen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), der Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) , der EU-Taxonomie Regulierung und CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) mit sich. Wir behandeln hier die vorgeschlagenen Änderungen der CSRD und CSDDD.
Geplante CSRD-Anpassungen
Der Omnibusvorschlag enthält wesentliche Änderungen der CSR-Richtlinie, die unter anderem eine Verkleinerung des Kreises der betroffenen Unternehmen und eine Reduzierung der Berichtspflichten vorsehen.
So soll die Berichtspflicht nur noch für Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitenden gelten, die entweder einen Umsatz von mehr als 50 Millionen Euro oder eine Bilanzsumme von mehr als 25 Millionen Euro oder beides aufweisen. Für kapitalmarktorientierte KMU entfällt die Berichtspflicht.
Hinsichtlich der Berichtsinhalte wird die Anzahl der verpflichtenden Datenpunkte reduziert, wobei diejenigen Angaben entfallen, die für eine allgemeine Nachhaltigkeitsberichterstattung als am wenigsten relevant erachtet werden. Zudem wurde die Einführung von sektorspezifischen Standards gestrichen. Ausserdem wird die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht das Niveau der Finanzberichterstattung erreichen, sondern langfristig nur mit eingeschränkter Sicherheit erfolgen.
Einschätzung Olmar Albers: Olmar Albers gewinnt den geplanten Anpassungen der CSRD sowohl Positives als auch Negatives ab. “Als gute Nachricht sehe ich, dass die Anzahl der verpflichtenden Datenpunkte für die Unternehmen reduziert wird und sie sich auf die Umsetzung der unternehmerischen Nachhaltigkeit konzentrieren können. Dies ist vor allem für mittlere und kleine Unternehmen eine Hilfe, da sie weniger Aufwand haben und ihren Kunden weniger Daten zur Verfügung stellen müssen. Gleichzeitig sehe ich einen klaren Nachteil darin, dass die Zahl der berichtspflichtigen Unternehmen massiv reduziert wird und die Überprüfbarkeit der Berichte nur eingeschränkt bleibt.”
Geplante CSDDD-Anpassungen
Auch für die CSDD ergeben sich Änderungen, wie die Verschiebung der Umsetzungsfrist (um ein Jahr auf 2028) und die Erleichterung der Sorgfaltspflichten. Die betroffenen Unternehmen benötigen keine Transparenz mehr über die gesamte Lieferkette, sondern nur noch über ihre direkten Lieferanten. Auch die Anzahl der Berichtszyklen verringert sich. So müssen Unternehmen ihre Massnahmen zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht nur noch alle fünf Jahre und nicht mehr jährlich überprüfen.
Letztlich beinhalten die vorgeschlagenen Anpassungen auch eine Änderung auf der Durchsetzungsebene, sowohl bei bei der zivilrechtlichen Haftung als auch bezüglich Geschäftsbeziehungskonsequenzen. So gibt es keine EU-weite zivilrechtliche Haftung. Die Mitgliedstaaten regeln die zivilrechtliche Haftung national, statt sie EU-weit zu harmonisieren. Wenn Lieferanten langfristig nicht CSDDD konform agieren, kann die Geschäftsbeziehung trotzdem weiter bestehen, ohne Konsequenzen.
Einschätzung Olmar Albers: Die Durchsetzbarkeit der CSDDD wird durch die nicht harmonisierten Haftungspflichten und die fehlende Verpflichtung zur Beendigung der Geschäftsbeziehung mit Direktlieferanten bei Nichterfüllung der Anforderungen in Frage gestellt. Persönlich finde ich es schade, dass sich die Sorgfaltspflicht nur auf direkte Lieferanten bezieht. Damit wird die Chance vertan, die gesamte Lieferkette besser zu verstehen und Risiken besser einzuschätzen."
Warum Unternehmen weiterhin auf Nachhaltigkeitsmanagementprozesse wie CSRD setzen sollten
Zunächst ist festzuhalten, dass es sich bei den Änderungen lediglich um einen politischen Vorschlag und nicht um ein Gesetz handelt. Dieser bedarf der Zustimmung des Europäischen Parlaments und des Rates der EU. Das Gesetzgebungsverfahren wird Monate dauern und kann wiederum Änderungen mit sich bringen. Darüber hinaus bleiben strategische Themen wie Kreislaufwirtschaft, Biodiversitätsmanagement, Dekarbonisierung und Abbau von Ungleichheiten unabhängig von mehr oder weniger Regulierung zentral.
Olmar Albers ergänzt: “Die EU bekennt sich mit dem Festhalten am Green Deal und der Ankündigung des Förderprogramms "European Clean Industry Act" weiterhin zu einer langfristigen Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Nachhaltigkeitsbemühungen der Unternehmen bleiben also essenziell und zahlen sich aus. So können Unternehmen durch die Berichterstattung nicht nur sicherstellen, dass sie ihrer Verantwortung nachkommen, sondern auch einen besseren Überblick über ihre Lieferketten gewinnen, Risiken minimieren und Wettbewerbsvorteile erzielen.
Dennoch bleibt es von staatlicher Seite, sowohl für die Schweiz als auch für die EU, zentral, für klare Verhältnisse zu sorgen und einmal eingeschlagene Wege konsequent zu verfolgen. Dies ist wichtig, damit Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten planen und zuverlässig umsetzen können.”
Der Bericht ist als Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte und Einordnung aus Sicht von öbu zu verstehen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Quellen
Foto von Casey Horner auf Unsplash